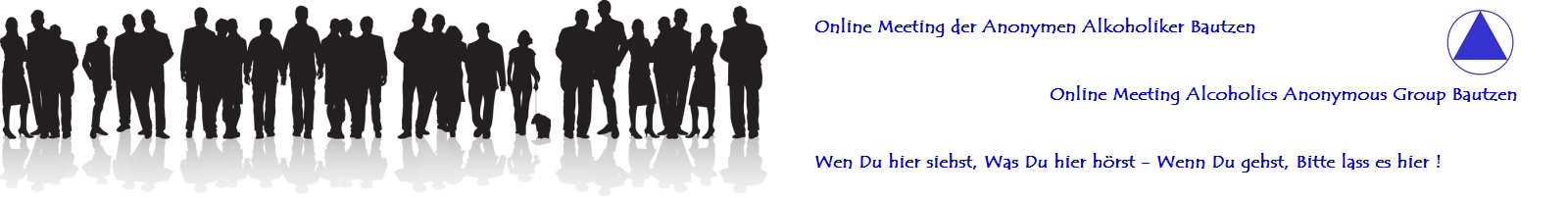Alkoholismus ist eine Krankheit – Ihre Phasen und ihre Symptome
Alkoholiker sind übermässige Trinker, deren Abhängigkeit vom Alkohol einen solchen Grad erreicht hat, dass sie deutlich Störungen und Konflikte in ihrer körperlichen und geistigen Gesundheit, ihren mitmenschlichen Beziehungen sowie in ihren sozialen und wirtschaftlichen Funktionen aufweisen. Nach längerem Alkoholmissbrauch sind deutlich zwei Gruppen von Alkoholkern zu unterscheiden.
Während sich bei der einen Gruppe der Kontrollverlust über die Alkoholaufnahme einstellt, entwickelt sich dieses Phänomen bei der anderen Gruppe niemals. Die Gruppe mit dem Verlust der Selbstkontrolle wird „alkoholsüchtig“ genannt.
Wer ist alkoholsüchtig?
Der Drang des Alkoholsüchtigen zeigt sich jeweils darin, dass beim Genuss kleiner Alkoholmengen ein Verlangen nach mehr Alkohol entsteht. Dieses Verlangen stillt der Süchtige meist mit hochprozentigen Getränken. Der Verlust der Selbstkontrolle führt in der Regel zu schwerer Trunkenheit. Nach diesem Ereignis kann er sich für Tage oder Wochen vom Trinken fernhalten, d.h. er ist imstande, mit dem Trinken vorübergehend aufzuhören.
Was sind „nichtsüchtige“ Alkoholiker?
Hierunter versteht man Trinker, die tagaus, tagein, vom Aufstehen bis zum Schlafengehen Bier oder Wein und dazwischen auch Schnäpse zu sich nehmen, – aber dennoch nicht die Fähigkeit verlieren, ihre Alkoholaufnahme zu regulieren. Sie sind imstande den Grad ihrer Vergiftung den Umständen anzupassen, in denen sie sich gerade befinden. Aber sie können nicht veranlasst werden, für einige Tage abstinent zu sein, – auch wenn ihnen klar wird, dass Weitertrinken zu schwerer Krankheit oder anderen ernsten Konsequenzen führt. Sie sind unfähig, mit dem Trinken aufzuhören.
Süchtige und nichtsüchtige Alkoholiker sowie Menschen, die Vorläufer einer solchen Entwicklung zeigen, sind krank. Daher brauchen sie Behandlung. Die Behandlung soll sich nicht nur auf die organischen Schäden, sondern auch auf die geistigen seelischen und sozialen Nebenwirkungen des Alkoholismus erstrecken.
Wie entsteht die Alkoholkrankheit?
Der erste Beginn des Genusses alkoholischer Getränke ist beim späteren Alkoholiker meist gesellschaftlich motiviert. Im Gegensatz zum „Normalverbraucher“ empfindet er aber bald eine befriedigende Erleichterung im Trinken. Anfänglich schreibt er seine Erleichterung eher der lustigen Gesellschaft oder dem Fest zu als dem Trinken. Daher gibt er sich in Zukunft gern in Gesellschaften bei denen beiläufig getrunken wird. Im Anfang sucht er nur gelegentlich Erleichterung. Der Alkoholgenuss führt noch nicht zur offenen Trunkenheit. Sein Trinken erscheint weder seinen Freunden noch Ihm selbst verdächtig. Nach einer gewissen Zeit kann eine Erhöhung der Alkoholverträglichkeit festgestellt werden, d.h. der Trinker braucht eine grössere Menge Alkohol, um das gewünschte Beruhigungsstadium zu erreichen. Diese Trinkmethode dauert je nach den Umständen mehrere Monate bis zu zwei Jahren. Ernste Anzeichen für eine spätere Sucht bilden plötzlich auftretende Erinnerungslücken. Hierbei zeigt der Trinker kaum Anzeichen von Trunkenheit. Er kann vernünftige Unterhaltung führen, schwierige Arbeiten leisten, Auto fahren, ohne am nächsten Tag eine Spur von Erinnerung zu haben, was er gesagt bzw. getan hat, oder wo er seinen Wagen abgestellt hat. Bier, Wein und Spirituosen beginnen dann praktisch aufzuhören, Getränke zu sein. Sie werden zu Quellen für eine Medizin, die der Trinker „braucht“.
Gewisse Gewohnheiten deuten darauf hin, dass es dem Trinker bewusst wird, dass er anders trinkt als andere Leute. Er entwickelt deshalb Schuldgefühle und beginnt bei Unterhaltungen Anspielungen auf Alkohol aus dem Wege zu gehen. Er fühlt sich dauernd beobachtet und sucht bewusst nach Gelegenheiten, ein paar Gläser ohne Wissen der anderen zu trinken. Dieses heimliche Trinken führt zu einem dauernden Denken an Alkohol.
Der Trinker kann es oft nicht erwarten, bis sich ihm eine Gelegenheit bietet, wo er ein oder zwei Gläser unbeobachtet gierig hinunterkippen kann. Dieses Benehmen zusammen mit der zunehmenden Häufigkeit der auftretenden Gedächtnislücken wirft den Schatten de Alkoholsucht voraus. Es ist ein Warnzeichen.
Spielt die Alkoholmenge eine Rolle?
Der Verbrauch alkoholischer Getränke ist höher als früher, fällt aber nicht auf, da er zu keinem deutlichen Rausch führt. Die Wirkung ist so, dass der spätere Süchtige gegen Abend ein Stadium erreicht, das als „Narkose der Seele“ bezeichnet werden kann.
Dieser Zustand ist nicht von der Menge des genossenen Alkohols abhängig. Das Trinken ist aber auf einer Stufe angelangt, auf der es Nerven- und Stoffwechselvorgänge zu stören beginnt.
Die Verharmlosung des Problems welches der Trinken in diesem Stadium versucht, ist ein ernstes Zeichen dafür, dass sein Trinken ihn von der Gesellschaft trennen könnte, obwohl es anfänglich als Mittel zur Überwindung eines Mangels an sozialer Beteiligung gedient haben mag. Noch ist der Trinker im medizinischen Sinn nicht alkoholkrank, doch führt der weitere stetige Verbrauch alkoholischer Getränke unwillkürlich zu Alkoholsucht.
Was kennzeichnet die kritische Phase?
Die kritische Phase wird durch den „Kontrollvelust“ gekennzeichnet. Der Verlust der Kontrolle bedeutet, dass beim Trinken ein unkontrollierbares Verlangen nach mehr Alkohol entsteht, sobald eine kleine Alkoholmenge in den Körper gelangt ist. Das Verlangen hält an, bis er für eine weitere Alkoholaufnahme zu betrunken oder zu krank ist. Dieser Exzess braucht übrigens nicht durch irgendein individuelles Bedürfnis eines Augenblicks eingeleitet zu werden, sonder oft schon durch ein angebotenes „gesellschaftliches“ Glas.
Nach der Genesung vom Rausch ist es nicht das unkontrollierbare körperliche Verlangen welches nach einigen Tagen oder Wochen wieder zu einem neuen Exzess führt, sonder der Wiederbeginn des Trinkens wird von ursprünglichen Konflikten oder durch einen einfachen gesellschaftlichen Anlass, bei dem getrunken wird, eingeleitet. Der Kontrollverlust wirkt erst, nachdem der Mensch mit Trinken angefangen hat, aber er hat vorher immer die Willenskraft, zu entscheiden, ob er bei einer Gelegenheit trinken will oder nicht. Dies wird durch die Tatsache bestätigen, dass der Trinker nach dem Auftreten des Kontrollverlustes durch eine Periode freiwilliger Abstinenz gehen kann.
Warum trinkt der Alkoholiker?
Oft wird die Frage erhoben, warum der Trinkern nach wiederholten, verhängnisvollen Erfahrungen immer wieder trinkt. Wenn er es auch nicht zugeben wir, so glaubt der Alkoholsüchtige doch, dass er seine Willenskraft verloren hat und sie wieder erlangen kann und muss. Er ist sich nicht bewusst, dass in ihm ein Vorgang abläuft, der ein Phänomen darstellt und es ihm unmöglich macht, nach dem ersten Glas aufzuhören. Die erneute Beherrschung seines Willens wird für ihn zur wichtigsten Angelegenheit. Die dadurch entstehenden Spannungen löst er mit nur „einem Glas“ – und er ist fest überzeugt, dass es diesmal nur bei einem oder zwei bleiben wird.
Weshalb lügt der Trinker?
Es sind Notlügen. Praktisch zusammen mit dem Beginn des Kontrollverlustes versucht der Suchtkranke sein Trinkverhalten zu erklären. Er produziert die bekannten Alkoholikerausreden. Er findet Erklärungen, die ihn selbst davon überzeugen, dass er die Kontrolle nicht verloren hat, sondern guten Grund hatte, sich zu betrinken, und dass er ohne solche Veranlassung durchaus imstande sei, den Alkohol wie jeder andere zu geniessen oder stehen zu lassen.
Die Erklärungen geben ihm die Möglichkeit wieder zu trinken, was für ihn von grösster Wichtigkeit ist, da er keine andere Möglichkeit zur Lösung seiner Probleme kennt. Dies ist der Anfang eines ganzen Erklärungssystems, das sich immer mehr auf jede Ebene seines Lebens ausbreitet. Es dient nicht zuletzt dem Widerstand gegen eine gesellschaftliche Ächtung, denn jetzt fällt seine Trinkart auf. Eltern, Ehegatten Geschwister, Freunde, Arbeitgeber und Kollegen beginnen den Alkoholkranken zu tadeln und zu warnen. Trotz aller Erklärungen besteht ein deutlicher Verlust an Selbstachtung. Eine Art Kompensation ist die übergrosse Selbstsicherheit nach aussen, die der Suchtkranke in dieser Zeit an den Tag zu legen beginnt. Extravagante Verschwendung und grossspurige reden überzeugen ihn selbst, dass er noch nicht so schlecht dran ist, wie er manchmal gedacht hat.
Wieso trinkt er heimlich?
Aus dem Erklärungssystem entsteht ein System der Isolation. Die Erklärungen führen ganz natürlich zu der Ansicht, dass der Fehler nicht bei ihm, sonder bei den andern liegt. Dies hat wiederum eine fortschreitende Abkehr von der sozialen Umgebung zur Folge. Der Alkoholiker verliert seine Freunde. Gegenüber seiner Familie zeigt er ein auffälliges aggressives Verhalten. Diese Fehlhaltung lässt unweigerlich eine Schuld entstehen, die sich nun im fortgeschrittenen Stadium als ein dauernde Zerknirschung äussert. Diese zusätzliche Belastung ist ein neuer Anlass zu Trinken, jedoch erfolgt die Alkoholaufnahme nun nicht mehr vor den Augen der Angehörigen und Freunde, sonder heimlich. Oft gerät der Alkoholiker dabei in Gesellschaftskreise, die weit unter seinem Früheren Niveau liegen.
Erzwungene Abstinenz – neue Hoffnung?
Dem sozialen Druck folgend, durchläuft der Suchtkranke jetzt mehr oder weniger unfreiwillige Perioden völliger Abstinenz. Er glaubt selbst, dass seine Schwierigkeiten nur dadurch zu kontrollieren sind, dass es sein Trinksystem ändert, indem er Regeln aufstellt, nicht vor einer bestimmten Tageszeit, nur an bestimmten Orten, nur diese oder jene Alkoholart oder auch nur zwei, drei Gläser zu trinken. Die Unkenntnis der Umgebung, die ihn wissen lässt, dass z.B. „ein Glas Wein“ oder „ein Glas Bier“ nicht schadet, bestärkt ihn noch in dieser Haltung. Die Anstrengung des Kampfes vermehrt seine Feindseligkeit gegen seine Umgebung, und er beginnt Freunde fallen zu lassen und Arbeitsplätze zu wechseln. Die Isolierung wird immer betonter, da sich sein ganzes Benehmen auf den Alkohol konzentriert. Er beginnt zu bedenken, wie eine bestimmte Arbeit sein Trinken stören könnte, anstatt – wie sein Trinken die Arbeit beeinflussen könnte.
Weshalb denkt er nur an sich?
Mit dem Verlust der zwischenmenschlichen Beziehungen im Freundeskreis und am Arbeitsplatz fühlt er sich einsam und verlassen. Jegliches Fehlen äusserer Interessen ist mit einem auffallenden Selbstmitleid verbunden. Isolation und Erklärungen haben jetzt an Ausmassen zugenommen und finden ihren Ausdruck entweder in gedanklicher oder tatsächlicher geographischer Flucht. Unter dem Eindruck dieser Vorfälle tritt eine Änderung im Familienleben ein. Frau und Kinder, die im gesellschaftlichen Leben gestanden haben mögen, ziehen sich aus Angst zurück oder können auch ganz im Gegenteil eine ausgiebige Betriebsamkeit entwickeln, um aus der häuslichen Umgebung zu entfliehen. Diese und andere Vorkommnisse führen zum Entstehen eines grundlosen Unwillens beim Alkoholsüchtigen. Das vorherrschende Interesse am Alkohol veranlasst den Süchtigen, sich heimlich Vorräte zu sichern.
Was heisst: „Alkoholische Eifersucht“?
Die Vernachlässigung einer angemessenen Ernährung macht die Auswirkungen des Trinkens auf den Organismus immer schwerer. Eine der häufigsten organischen Beschwerden ist die Abnahme des Sexualtriebes. Der Alkoholiker empfindet ein starkes „Wollen“, – doch scheitert er am „Können“. Dadurch vermehrt sich die Feindschaft gegen die Ehefrau, und er verdächtigt sie oft grundlos des ausserehelichen Geschlechtsverkehrs. Sein unerfüllbares Verlangen nach sexueller Entspannung veranlasst ihn zu der nun gut bekannten alkoholischen Eifersucht. Der geschilderte Krankheitsprozess unterminiert fortschreitend den moralischen und körperlichen Widerstand des Süchtigen, und häufig kommt es jetzt zur ersten Einweisung in ein Krankenhaus wegen irgendwelchen Beschwerden, die der Trinker selbst aber nie auf seinen Alkoholmissbrauch zurückführt. Er erschwert die Diagnose des Arztes durch vorsätzliche falsche Angaben über seinen Alkoholkonsum.
Ist der Alkoholiker willensschwach?
In der kritischen Phase erlebt der Trinker einen ständigen Kampf zwischen Alkoholverlangen und Pflichterfüllung. In dieser Zeit haben Gewissensbisse, Verlust der Selbstachtung, Zweifel und falsche Ermutigungen den Süchtigen so zerrüttet, dass er den Tag nicht beginnen kann, ohne sich nach den Aufstehen oder noch vorher mit Alkohol zu beruhigen. Verzweifelt kämpft er während der Arbeitszeit gegen sein Alkoholverlangen. Er strengt sich besonders an, um einen Rausch während des Tages zu vermeide. Sobald jedoch der Feierabend naht, kann er sich nicht mehr zurückhalten, und gegen Abend ist dann der Rausch erreicht. Gelegentlich verursachen die Nachwirkungen des abendlichen Rausches am nächsten Morgen Beschwerden beim Aufstehen, aber im Allgemeinen kann der Süchtige seiner Arbeit nachgehen, wenn er auch seine Familie vernachlässigt. Die kritische Phase präsentiert durchweg den heftigen Kampf des Süchtigen gegen den völligen Verlust der sozialen Basis.
Woran erkennt man die „chronische Phase“?
Die zunehmende beherrschende Rolle des Alkohols und das durch das morgendliche Trinken entstandene Verlangen brechen schliesslich den Widerstand des Süchtigen. Zum ersten Male findet er sich am Tage und mitten in der Woche betrunken. In diesem Stadium verharrt er einige Tage, bis er völlig unfähig ist, irgendetwas zu unternehmen. Oft kommt es nun zu einer ersten Einweisung in eine Trinkerheilstätte oder in ein psychiatrischen Krankenhaus. Die ausgedehnten Exzesse haben gewöhnlich einen bemerkenswerten ethischen Abbau und eine Beeinträchtigung des Denkens zur Folge. Bei etwa 10% aller Alkoholiker können jetzt auch echte alkoholische Psychosen, d.h. eigentliche alkoholische Geistesstörungen auftreten. Der Verlust der Moral ist so hoch, dass sich der Süchtige nicht mehr scheut, Frau und Kinder zu verprügeln, und jedes Mittel ist recht, um an den notwendigen Alkohol zu kommen. Wenn er nicht anderes zur Verfügung hat, nimmt er zu technischen Produkten Zuflucht, wie Haarwasser, Franzbranntwein oder Brennspiritus, – oder er besäuft sich an minderwertigen Wermutweinen.
Wie endet, was so harmlos begann?
Undefinierbare Ängste und ständiges Zittern werden eine Dauererscheinung. Da diese Symptome vor allem dann auftreten, wenn der Alkohol aus dem Körper verschwindet, muss nun der Kranke immer nachtrinken. Demzufolge kuriert der Süchtige die Symptome mit Alkohol. Damit nimmt das Trinken den Charakter einer Besessenheit an. Bei vielen Süchtigen entwickeln sich unbestimmte religiöse Wünsche, während die Erklärungsversuche schwächer werden. Schliesslich werden im Laufe der ausgedehnten Exzesse die Erklärungen so unbarmherzig der Wirklichkeit gegenüber gestellt, dass das ganze Erklärungssystem versagt und die Niederlage vom Süchtigen zugegeben wird. Als Folge hiervon erlebt der Kranke seelische Zusammenbrüche schwerster Art, die eine Behandlung in einem psychiatrischen Krankenhaus notwendig machen.
Selbstmordversuche sind in diesem Stadium der Erkrankung nicht selten. Ein Teil der Kranken zeigt als Folgeerscheinung bei weiterem Alkoholgenuss das Phänomen des gespaltenen Menschen. Die Persönlichkeit wandelt sich. Das Phänomen der Spaltung tritt besonders deutlich in den Alkoholpsychosen hervor, die vielfach auch an Täuschungen der Sinne gebunden sind. Als Alkoholdilirium ist diese Krankheitsform bekannt. Sie ist die letzte Station eines völligen Niederganges der Persönlichkeit und des menschlichen Lebens.
Ist Alkoholismus heilbar?
Nein! Wer einmal über die Schwelle des Kontrollverlustes gegangen ist, kann auch nach Jahren der völligen Abstinenz nie mehr kontrolliert trinken. Die Krankheit kann aber zum Stillstand gebracht werden, wenn der Alkoholiker ein völlig neues Leben ohne Alkohol führt.